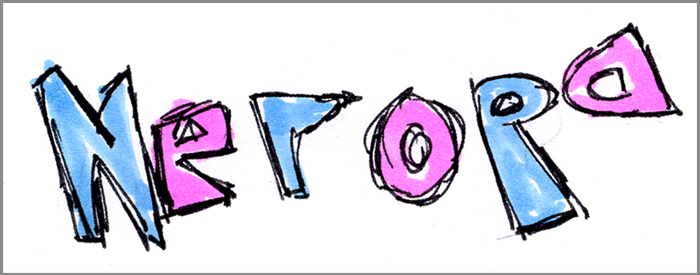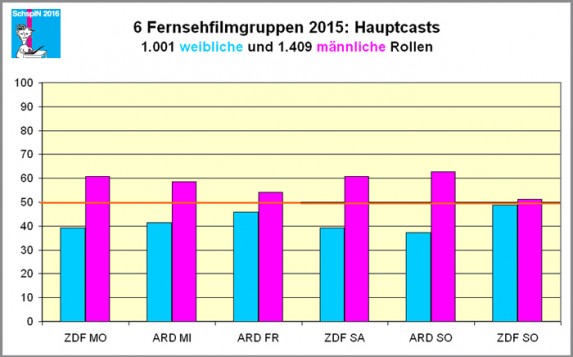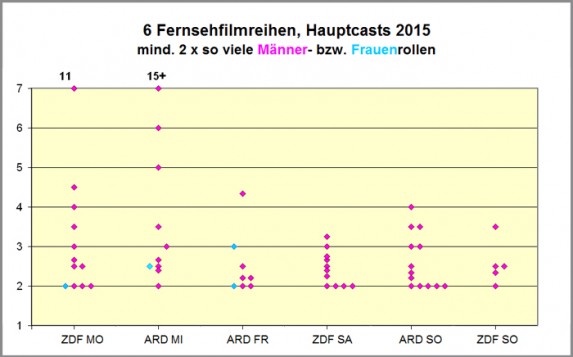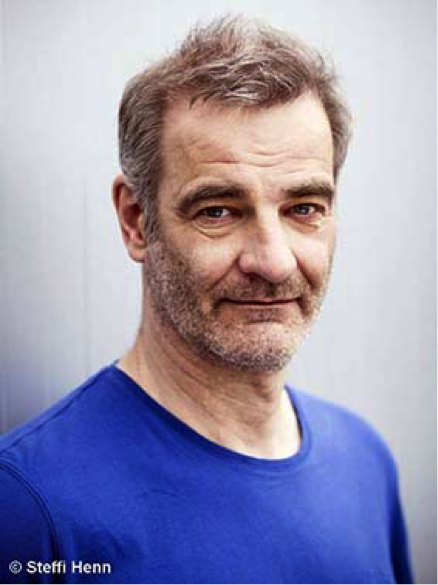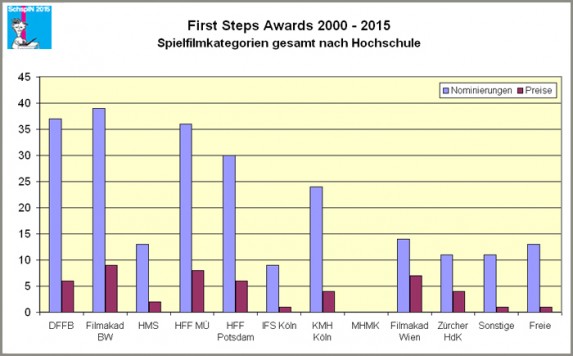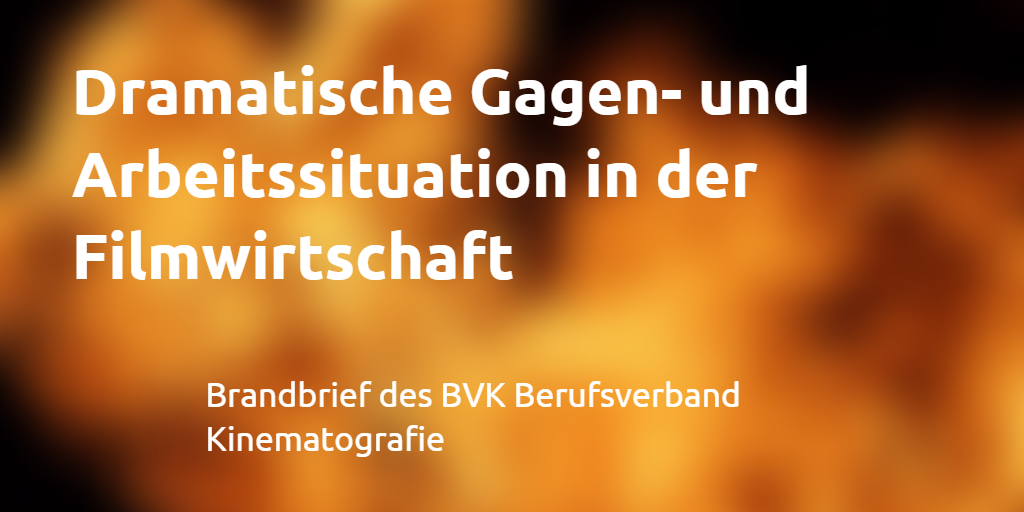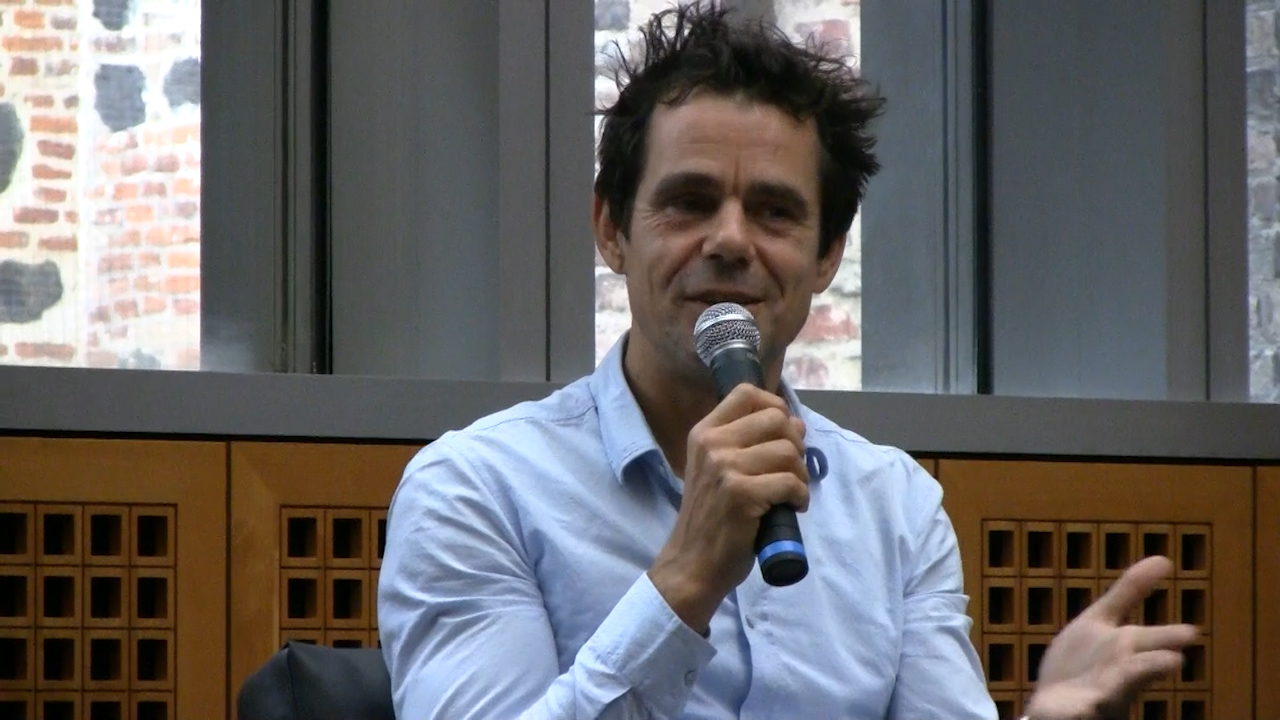Standbild aus 'Mitten im Leben' © RTL
Britta Steinwachs über die Inszenierung einer „Unterschicht“ in Fernsehsendungen des so genannten „Scripted Reality“. Britta Steinwachs ist Soziologin und befasst sich ideologiekritisch mit popkulturellen Phänomenen. Das Interview führte Patrick Schreiner[*].
Der Beitrag steht auch als Podcast zur Verfügung.
Sie befassen sich in Ihrem Buch „Zwischen Pommesbude und Muskelbank“[**] mit der „Inszenierung der Unterschicht“ im Fernsehen. Was ist Scripted Reality, und welche Rolle spielt sie bei eben dieser Inszenierung?
Britta Steinwachs: Scripted Reality ist ein Sammelbegriff für eine in den vergangenen Jahren aufgekommene Vielzahl an Fernsehformaten, die pseudo-dokumentarische Techniken mit einer klar vorstrukturierten Erzählung verbinden. Viele kennen da sicher Sendungen wie „Mitten im Leben“ oder „Familien im Brennpunkt“. Im Scripted Reality werden drehbuchbasierte Geschichten erzählt, die wie mitten aus dem alltäglichen Leben gegriffen wirken sollen. Dabei werden einerseits Techniken des Dokumentarfilms angewendet, wie zum Beispiel verwackeltes Filmen mit einer Handkamera. Auf diese Weise wird der Eindruck erweckt, es handle sich um authentische Szenen, bei denen „nur die Kamera draufgehalten wird“. Andererseits arbeiten diese Formate gezielt mit Laiendarsteller_innen, deren Körper und Wohnort zum Spielball einer zwiespältigen Inszenierung zwischen fiktiver Konstruktion und lebensweltlicher Authentizität wird. All das, was sich mit dem klassenspezifischen Habitus der Darsteller_innen umreißen lässt (also zum Beispiel spezifisches Körperempfinden und Körpersprache sowie Kleidungsstil), wird damit als zentrales Gestaltungselement in den medialen Produktionsprozess integriert.
Welche Funktion oder Rolle nimmt dieser „klassenspezifische Habitus“ ein?
Britta Steinwachs: Die in den Sendungen dargestellten Verhaltensweisen und Geschmäcker der Akteur_innen sind keine zufälligen Besonderheiten einzelner Charaktere, sondern verweisen immer auch auf gesellschaftliche Strukturen. Dem Habitus kommt also eine symbolische Dimension zu: Wenn man einen unbekannten Menschen im Fernsehen sieht und dort gezeigt wird, wie er sich kleidet, spricht, artikuliert usw., dann lässt sich daraus stets mehr als das direkt Gezeigte ablesen. Mit einem intuitiven Sinn erkennt das Publikum – oft auch unbewusst – meist sofort, welcher sozialen Klasse das Gegenüber angehört. Wenn im Fernsehen nun mithilfe von Laiendarsteller_innen vermeintlich realistische Alltagsgeschichten erzählt werden, ergibt sich daraus die besondere Konstellation, dass sich hier der „reale“ Habitus von Menschen mit einer fiktiven Erzählung verwebt. Aus diesem Grund wirken die Figuren in ihrer halbrealen und halbfiktiven Körperlichkeit authentisch. Dies ist auch ein Grund für den großen Erfolg dieser Formate.