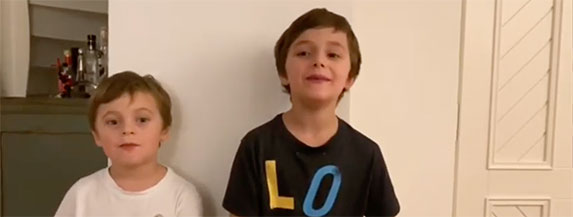
#wirbleibenzuhause: Auf Youtube melden sich die Nachbarn aus Österreich zu Wort. | Screenshot
Reihenweise schalten Produktionen auf Pause oder werden abgesagt, an anderen Orten wird noch gedreht. Die Lage ist unübersichtlich, Produzent*innen können und müssen noch selbst entscheiden. An vielen Filmschaffenden gehen die versprochenen Hilfsmaßnahmen vorbei. Bei der Suche nach Lösungen kommt auch ein umstrittenes Konzept wieder in die Diskussion. Wir danken Ihnen für Ihre Ergänzungen und Korrekturen, Fragen und Kommentare an (Aktiviere Javascript, um die Email-Adresse zu sehen).
Zur Einstimmung ein kurzes Video.
Gestern tagte in Wiesbaden der Krisenstab der Hessischen Landesregierung. Der wurde 2005 geschaffen, um „für die Bewältigung einer landesweiten Lage von politischer Bedeutung“ die Maßnahmen quer durch alle Ressorts zentral zu steuern.
Es ist das erste Mal, dass der Krisenstab zusammengerufen wurde, sagte uns ein leitender Mitarbeiter der Landesverwaltung. „Das gab es bisher in Hessen noch nie und zeigt nochmals den Ernst der Lage.“
„Wir haben vollstes Verständnis für die Entscheidung der Produzenten, die Dreharbeiten vorerst um einige Wochen zu verschieben […] Wir sind es in unserem Projektgeschäft gewohnt, flexibel auf solche Situationen wie Verzögerungen, Verschiebungen oder Abbrüche zu reagieren. Das Personal auf den Projekten wird zum Teil weiterbeschäftigt. Bei einem Teil der Crew handelt es sich um Freelancer, zum Beispiel Handwerker, die auch nicht filmbezogene Aufträge annehmen, bei denen wir nur hoffen können, dass sie uns bei der Wiederaufnahme der Produktion noch zur Verfügung stehen.“ So zitierte die Süddeutsche Zeitung gestern Studio Babelsberg und versuchte einen Überblick der gegenwärtigen Produktionslandschaft. Der Titel ist Programm: „Wir machen weiter, solang es geht“.







