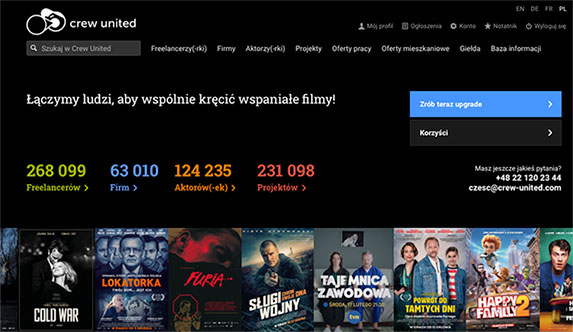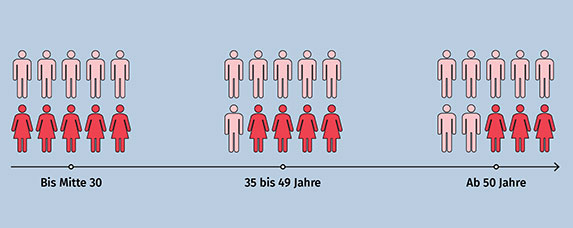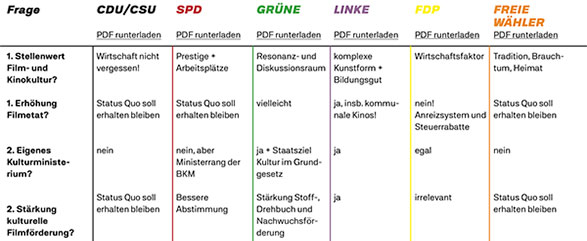Vor sieben Jahren erfuhren junge Schauspieler*innen ein Casting als Alptraum. In „The Case You“ erinnern fünf von ihnen das Erlebte. | Foto © Lenn Lamster/Mindjazz Pictures
Im Film „The Case You“ erinnern sich fünf junge Schauspielerinnen an ein Casting, bei dem sie gedemütigt, bedroht und sexuell belästigt wurden. Und vor Gericht klagen sie gegen die Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte.
Seit vor fünf Jahren die „MeToo-Bewegung“ loslegte, ist klar: Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe sind auch in der Filmbranche kein Einzelfall. In dem Dokumentarfilm „The Case You“, der zurzeit im Kino läuft, erinnert sich eine Gruppe junger Schauspielerinnen an ein Casting, bei dem sie gedemütigt, bedroht und sexuell belästigt wurden. Der Film war voriges Jahr mit dem „Deutschen Dokumentarfilmpreis“ (in der Kategorie Kultur) und beim Dokfest München mit dem „Student Award“ ausgezeichnet worden.
Was damals geschah, beschreibt Gabi Sikorski im „Filmdienst“: „Am Anfang stand eine seriös wirkende Casting-Einladung, das Drehbuch war beigefügt. Für die jungen Schauspielerinnen bot sich 2015 die Chance auf eine kleine oder größere Rolle. Mehr als 300 Mädchen und junge Frauen stellten sich vor; viele von ihnen waren noch keine 18 Jahre alt, manche unter 16. Die meisten waren naiv; der Traum von der Filmkarriere wischte alle Bedenken weg. Was dann allerdings auf die Frauen zukam, war ebenso überraschend wie schrecklich. Im Rahmen des Vorsprechens mussten sie sich entkleiden oder wurden dazu genötigt. Männer und Frauen aus dem Team begrapschten sie am ganzen Körper. Sie wurden angebrüllt, bedroht und geschlagen, alles ohne Vorbereitung oder Begründung. Viele weinten, doch niemand kam ihnen zu Hilfe. Ihre offenkundige Hilflosigkeit war Teil des Kalküls.“