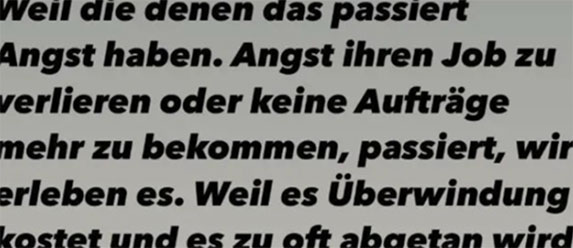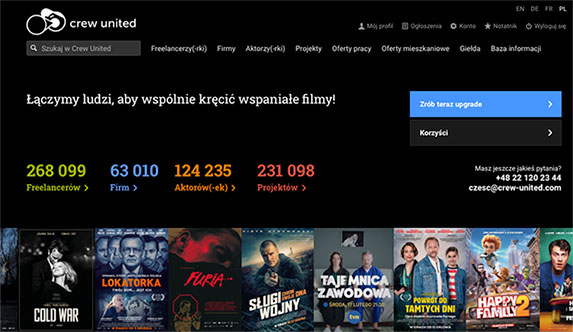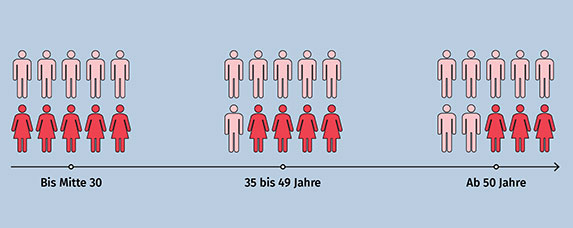Hinter den Kulissen wird wieder gestritten. Gewerkschaft und Schauspielverband haben mit Netflix verhandelt – mehrere Berufsverbände sehen sich ausgegrenzt. | Foto © Adobe Stock
Gleich dreimal in zwei Wochen hat der Regieverband gegen die Abmachungen zwischen Netflix und Verdi protestiert: Die Berufsverbände würden ausgegrenzt, das Ergebnis sei „ziemlich mau“. Statt der Gewerkschaft antwortete jetzt der Schauspielverband.
Der Zank um Netflix geht weiter. Der Bundesverband Schauspiel (BFFS) und die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hatten mit dem Streamer vor zwei Jahren Gemeinsame Vergütungsregeln (GVR) bei Netflix-Serien ausgehandelt. Vor zwei Wochen meldete Verdi: Netflix zahlt jetzt bei Serien nach Tarif. Und, ach ja, „außerdem werden auch Mindestgagen für Regisseur*innen geregelt, diese fügen sich in die bestehende GVR ein.“
Der Bundesverband Regie (BVR) protestierte. Und das gleich dreimal. Wobei die Vorwürfe gleich bleiben – sie werden aber zunehmend heftiger und ausführlicher vorgebracht. Verdi repräsentiere nicht die Regie, und das Ergebnis sei „noch dazu ziemlich mau“, hieß es in einer ersten Reaktion (wir berichteten auf „Outtakes“).
Sechs Tage später wurde der BVR heftiger: „Die Gewerkschaft verkauft die deutschen Regisseurinnen und Regisseure an Netflix“, schrieb der Verband über seine Stellungnahme. Und noch größer darüber: „Raus aus Verdi“. Der Berufsverband, dem rund 450 Fiction-Regisseur*innen angehören, hatte selbst zwei Jahre lang mit Netflix verhandelt. Die Verhandlungen waren vor wenigen Wochen gescheitert, die verpflichtende Schlichtung steht noch an. „Dass Verdi ohne Beteiligung des BVR nun Tarifgagen für die Regie festlege, sei „ein starkes Stück, das dieses Prozedere direkt angreift.“ Was die Regie betrifft, seien die bisherigen Verhandlungsergebnisse von Verdi in Deutschland die schlechtesten in ganz Europa, so der Regieverband. „Offenbar ist es Verdis Ziel, Deutschland als Billiglohnland gegen die europäischen Nachbarn zu positionieren.“