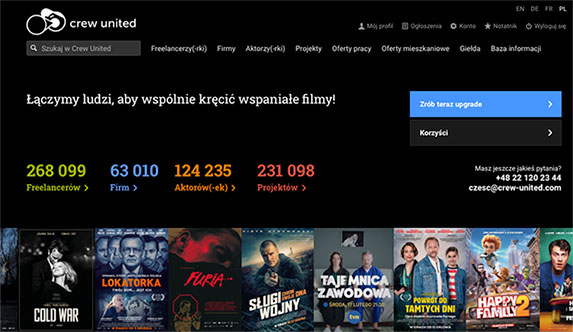Kulturstaatsministerin Claudia Roth (links) und MFG-Geschäftsführer Carl Bergengruen beim „Deutschen Produzententag 2023“. | Foto © Filmstiftung NRW/Severin Wohlleben
Die BKM hat eine filmpolitische Grundsatzrede gehalten. Das war Zeit, denn Claudia Roth ist seit mehr als einem Jahr im Amt, und das neue Filmförderungsgesetz wird dringlich erwartet. Die große Reform soll es werden, die dem Deutschen Film zu neuem Schwung verhilft.
Auf dem „Deutschen Produzententag“ stellte die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien am Donnerstag voriger Woche acht Eckpunkte für eine Reform der Filmförderung vor. Als Beispiel, was möglich sein sollte, nahm Claudia Roth den aktuellen deutschen Vorzeigeerfolg: Der nämlich „konfrontiert uns mit der Frage, warum unser gut ausgestattetes deutsches Fördersystem selten vergleichbare Erfolge erzielt. Denn, wie wir alle wissen: ,Im Westen nichts Neues’ ist eine Netflix-Produktion“, sagte Roth auf dem „Deutschen Produzententag“. Ihr Fazit: „Ziel einer Reform der Filmförderung kann deshalb nur sein, sie effizienter, sie schneller und ganzheitlicher zu machen.“
„Ganzheitlich“ ist ein großes Wort. Erst recht, wenn dabei ein Teil der Filmlandschaft ignoriert wird, der schon seit Jahren rapide wächst: Festivals sind längst zu einer eigenen wichtigen Auswertungs- und Werbeschiene geworden und haben offenbar auch keine Probleme, ihr Publikum zu finden. In den Eckpunkten der BKM werden sie nicht mal erwähnt – was allerdings auch keine Neuigkeit ist. Obwohl es doch, sechstens, darum gehe, „auch die Sichtbarkeit deutscher Filme zu erhöhen.“ Und wo doch die BKM ihre Ankündigung selbst nicht ohne Grund vor der Kulisse ihrer Berlinale machte.