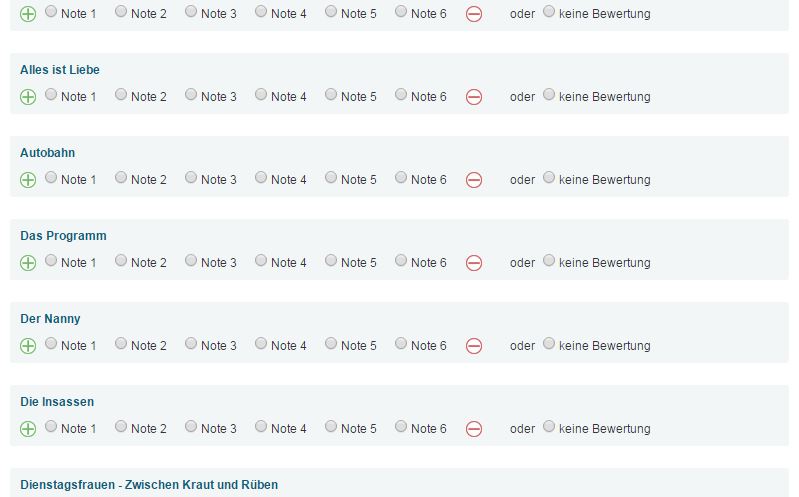Schlecht gemacht und am Publikum vorbei!?So harsch urteilt die Deutsche Filmakademie über den deutsche Filme. Schuld habe das gegenwärtige Fördersystem. | Foto © Deutsche Filmakademie, Franziska Krug
„Alle vier Jahre gibt es eine Fußballweltmeisterschaft, jedes Jahr einen Sommer, jede Woche zwei neue Netflix-Serien – und die Filmbranche trifft sich alle vier bis fünf Jahre zur FFG-Novelle.“ So richtig glaubt man bei der Deutschen Filmakademie wohl nicht an Besserung. Zumindest nicht durch das FFG. Nun wird es also im „52. Jahr zum 13. Mal“ überarbeitet, derweil „nicht davon auszugehen“ sei, „dass sich die Situation des deutschen Kinos und des deutschen Kinofilms fundamental verbessern wird.“
Derart fatalistisch beginnt die Deutsche Filmakademie ihre Stellungnahme zur Novellierung des Filmförderungsgesetzes (FFG), das 2022 in Kraft treten soll. Vier Punkte macht sie als Problem aus und beginnt gleich mit einem Paukenschlag:
1. Viele deutsche Kinofilme hätten „eine häufig zu niedrige Qualität“ und „fehlende Publikumsaffinität“ (übersetzt: sie sind schlecht gemacht und uninteressant).
Nanu! Streut sich da gerade jemand Asche aufs Haupt? Schließlich stellen doch die Sektionen Drehbuch, Regie und besonders Produktion den größten Teil der Akademie-Mitglieder. Doch von Ideenlosigkeit oder fehlendem Wagemut ist hier nicht die Rede. Das Problem hat für die Filmakademie allein einen betriebswirtschaftlichen Grund: „Viele interessante deutsche Kinofilmprojekte sind zum Zeitpunkt der Finanzierung unterentwickelt und gehen unterfinanziert in die Produktion.“
Also sind nur die Produzent*innen schuld? „Von einem Filmproduzenten spricht man, wenn er die wirtschaftliche und technische Verantwortung für die Produktion trägt, ihre Durchführung organisiert und sie inhaltlich beeinflusst“, erklärt die Wikipedia.
Aber nein, auch sie können in der Erklärkette der Filmakademie auch nichts dafür, denn …