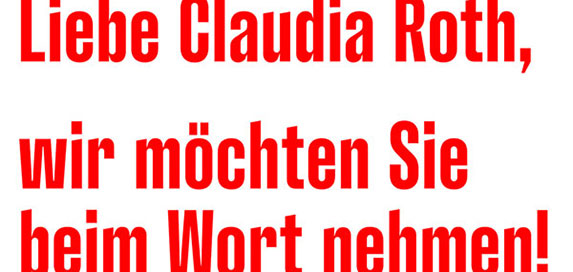Das Foto passt zur Stimmung, findet Benedict Neuenfels. | Foto © Sabin Tambrea
Neulich erhielten der DoP Benedict Neuenfels und sein Team noch die höchste Ehre, jetzt stehen sie vor einem Problem. Wie die Insolvenz bei Zero One sich auch auf andere in der Branche auswirkt.
Ausgezeichnet wurde Benedict Neuenfels schon oft. Zwei „Lolas“ für die beste Bildgestaltung hat er erhalten, zwei „Grimme-Preise“ und sogar siebenmal schon den „Deutschen Kamerapreis“. Und einen „Oscar“-Film hat er auch fotografiert. Anfang Mai kam noch der „Marburger Kamerapreis“ dazu. Das klingt ein bisschen kleiner, ist aber etwas ganz Besonderes für die Zunft. Einmal im Jahr steht ein*e DoP im Mittelpunkt, wird ein Gesamtwerk in Filmen, Gesprächen und Vorträgen gewürdigt, in denen Wissenschaft, Filmkritik und Kameraleute übers Kino sprechen und genauer hinsehen. Das zeigt sich auch in der Jurybegründung, die nicht nur die Arbeit mit bekannten Regisseur*innen erwähnt, sondern sich eingehend mit den Feinheiten der Bildgestaltung beschäftigt. Und dem, was dahinter steckt:
„Bei der erzählerischen und technisch-gestalterischen Arbeit kann sich Benedict Neuenfels jederzeit auf ein Kamerateam verlassen, das zum Teil seit fünfunddreißig Jahren mit ihm zusammenarbeitet. Dazu gehören Kameraassistent Andreas Erben, Key Grip Markus Pluta und Oberbeleuchter Rainer Stonus. Philip Wölke kam als Techniker für das Digitale Bild (DIT) und Berater für Green-ScreenAufnahmen vor 16 Jahren dazu und ist seither ein ebenso fester Bestandteil des Teams. Die Verleihung des Marburger Kamerapreises gilt also nicht Benedict Neuenfels allein, sondern ebenso seinem Team, das bei jeder gemeinsamen Arbeit aufs Neue eindrucksvoll demonstriert, dass auch Kameraarbeit immer auch als Kollaboration zu denken ist und nur ein gut eingespielter Verbund Außergewöhnliches zu leisten imstande ist.“
Soweit die gute Nachricht. Denn vorige Woche hat die Berliner Produktionsfirma Zero One Film Insolvenz angemeldet. Die Nachricht hat auch Neuenfels und sein Team kalt erwischt: